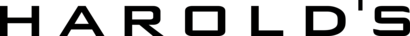Ihr Warenkorb ist leer
Tolles Leder, tolle Verarbeitung, tolle Farbe! Einzig der Riemen ist wirklich zu lang, werde ihn kürzen lassen
Die Tasche gefällt mir gut. Sie könnte ein wenig größer sein. Ich habe sie als Begleiterin für Städtetouren gedacht. Aber es könnte etwas schwierig werden, einen Reiseführer und andere Keinigkeiten zu verstauen. Die Qualität des Leders ist sehr angenehm und weich.
Sehr schöner Shopper, der von Qualität und Verarbeitung fünf Punkte verdient hätte. Die Abwertung kommt durch die beiden Reißverschlüsse. Während der Reißverschluss der kleinen Innentasche "nur" schwergängig ist, ist der Reißverschluss ider mittleren Innentasche nicht wirklich benutzbar. Er lässt sich nur mit viel Kraft öffnen und schließen. Die Kraft habe ich aber nicht. Das mittlere Fach steht jetzt offen.